



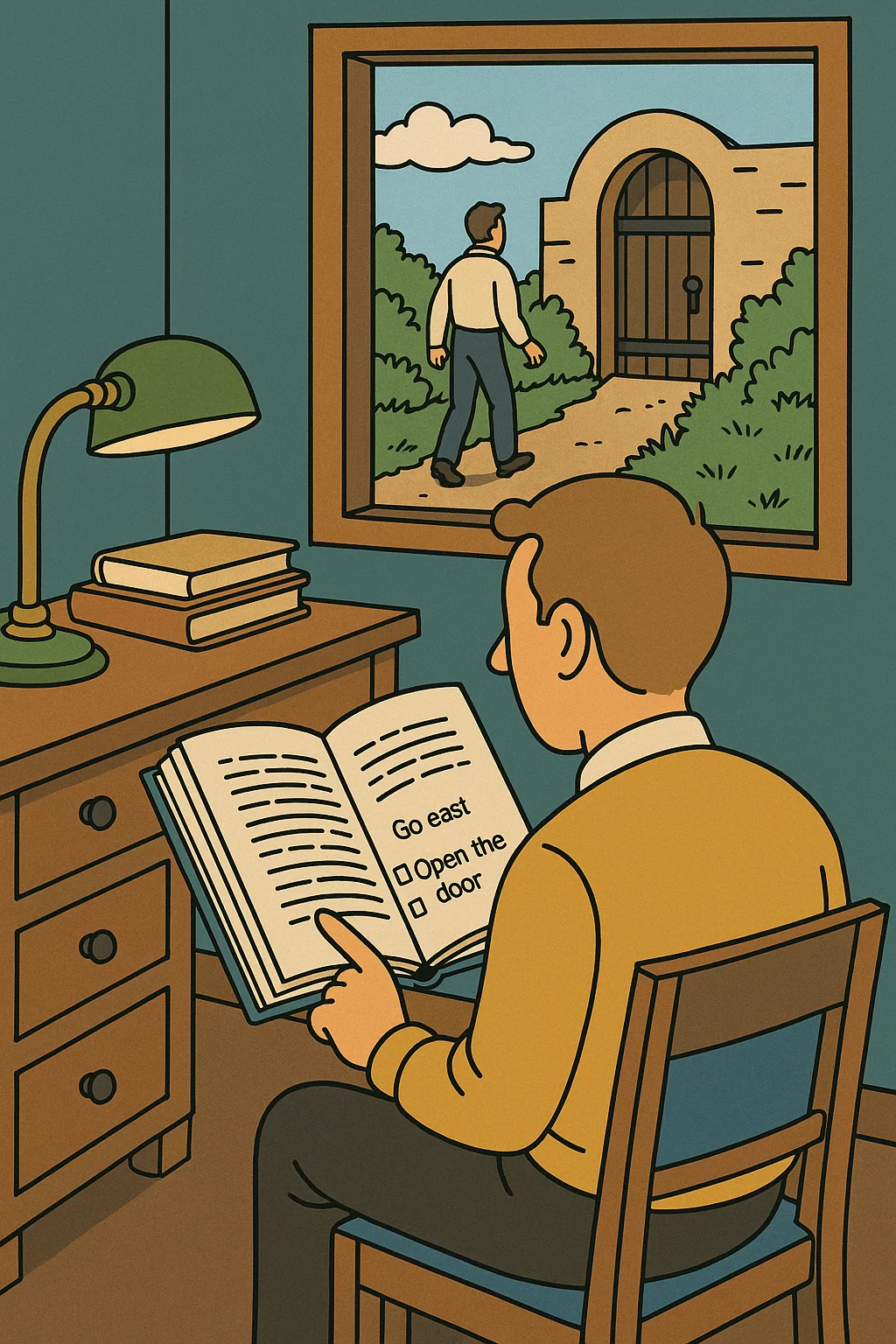

Text: Nadine Trautzsch
Bild oben: Sora (Prompt: Björn Brückerhoff)
Bild unten: Nadine Trautzsch/Dall-E, 2024

Interactive Fiction ist die Verbindung von Literatur und interaktiven Spielelementen, die es den Rezipienten nicht nur ermöglicht, die Handlung aktiv zu beeinflussen, sondern in Verbindung mit KI-Systemen auch gestattet, selbst zum Autor seiner Geschichte zu werden. Die Rezipienten, die Leserinnen, die Benutzer werden so vom passiven Konsumenten eines linearen Mediums zur „Erschafferin“, zum Gestalter. Interpretation wird also gleichzeitig zur Designhandlung, Semiotik als Methode, und so ist er semantisch nicht nur passive Interpret, sondern auch „Werker“ des „Werks“ (Gadamer, 1960) Mitschöpfer und Gestalter.
Dieser Artikel geht der Frage nach, welche Ursprünge und Entwicklung interaktive Geschichten haben und wie Interactive Fiction gestalterische Prozesse fördert, indem es den Spieler:innen narrative Freiräume zur Selbstgestaltung des Handlungsverlaufs gibt. Darüber hinaus bietet das Genre Möglichkeiten für Spieler:innen als Autor:in: mittels selbst entwickelter interaktiver Geschichten lernen Kinder und Jugendliche, Entscheidungen zu treffen, Handlungsmöglichkeiten zu erkunden und ihre Auswirkungen auszuprobieren. Neugierde und intrinsische Motivation treiben sie an, ihr kreatives Denken und ihre Selbstwirksamkeit wird gestärkt. Dabei gehen die Möglichkeiten der Interactive Fiction über das traditionelle Storytelling hinaus, indem es durch spielerische Herausforderungen die kognitiven und strategischen Problemlösungsfähigkeiten schult und das kritische Denken anregt. In Verbindung mit künstlicher Intelligenz sind die Benutzer:innen als Autor:in, Rezipient:in und gleichzeitig Akteur:in: Interaktive Geschichten, die KI- unterstützt entwickelt werden bieten viele Möglichkeiten, etwa die Erkundung multipler Szenarien oder die Simulation von Ideen und möglichen Zukünften an. Welche Herangehensweisen und Tools es für Interactive Storytelling mit und ohne KI-Unterstützung können wir bereits nutzen und in Lernumgebungen Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stellen?
Interactive Fiction kann als interaktives Medium, das Konzepte von Literatur, Spiel und Technologie nutzt, angesehen werden. Als Genre, das über den bloßen passiven Konsum hinausgeht und zu bewusster Mediengestaltung anregt, bereitet Interactive Fiction Kinder und Jugendliche auf eine Zukunft vor, in der digitale Kompetenz, kritisches Denken und Innovation wichtige Kernkompetenzen sein werden. Diese „weichen“ Kompetenzen, die „Future Skills“ wie im Framework vom Stifterverband und McKinsey & Company (2021) formuliert, sind wünschenswerte Fähigkeiten, genauso wie kritisches Denken, Formulieren und Diskutieren philosophischer Fragen und deren Einordnung und Reflexion. Interactive Fiction bietet genau das Potenzial, kreatives und analytisches Denken zu fördern. Es handelt sich somit um einen wertvollen Bildungsansatz, der die persönlichen und gesellschaftlichen Kompetenzen im digitalen Zeitalter nachhaltig fördert und stärkt. Für die KI-Kompetenzausbildung konzipierte Modelle, Tools und Plattformen für Kinder und Jugendliche könnten hier zum Tragen kommen. Durch die Analyse bestimmter Aspekte wie Erzählmerkmalen, Hybridität, Struktur, Publikumsführung und kulturellen Aspekten können Lehrpersonen visuelle Rhetorik als einen dynamischen Gestaltungsprozess vermitteln. Das Produzieren und reflexive Besprechen von KI-Texten und Geschichten bietet eine willkommene Rückkehr zu rhetorischen Prinzipien, Reflexion und eine wichtige Pädagogik des Schreibens und Gestaltens als Design.
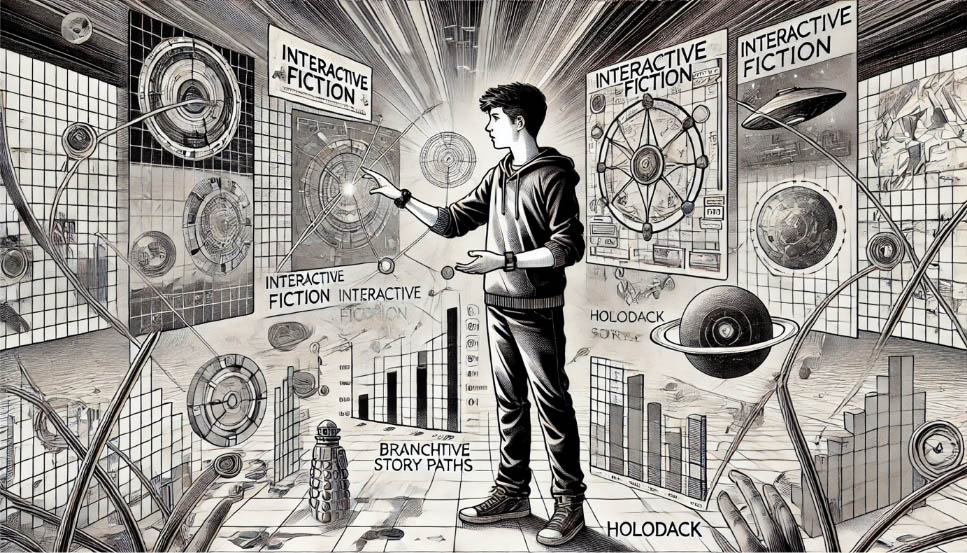
Bild: Trautzsch, 2024 Ein Bild zum Thema Interactive Fiction - Digital, Cyberspace, Holodeck. Dall-E, 2024.
Jane McGonigal entwirft in ihrem Band „Reality Is Broken – Why Games make us better and how they can change the world“ (2011) eine Vision und argumentiert, wie Spiele und Game Design-Potenziale für persönliches Wachstum, Problemlösung und die Gestaltung einer besseren Zukunft bieten. “A GOOD GAME is a unique way of structuring experience and provoking positive emotion. It is an extremely powerful tool for inspiring participation and motivating hard work. And when this tool is deployed on top of a network it can inspire and motivate tens, hundreds, thousands, or millions of people at a time. Anything else you think you know about games, forget it for now. All the good that comes out of games — every single way that games can make us happier in our everyday lives and help us change the world — stems from their ability to organize us around a voluntary obstacle” (McGonigal, 2011, S.33 ff).
Interactive Fiction in Verbindung mit künstlicher Intelligenz fördert nicht nur die Freude am Geschichtenerzählen und an der Kreativität, sondern kann als bewusst eingesetztes Werkzeug eine multiperspektivische Auseinandersetzung mit der Welt, die Reflexion individueller Weltbeziehungen des Rezipienten stärken und trägt somit als ein Medium das Erzähltechniken und Spielelemente verbindet, zur Entwicklung problemlösungsorientierter Zukunftskompetenzen bei.
Die Ursprünge des Interactive Fiction Formats, Genres und ein „Maschineller“ Plot-Roboter
Jeder, der Kinder hat oder sich mit ihnen beschäftigt, weiß, wie überaus spannend die kindliche Sichtweise und ihr Verständnis (oder die Konstruktion) von Zusammenhängen ist. Ihre mentalen Modelle bilden sich erst in der Interaktion mit ihrer Umgebung aus.
Im noch freieren Geist von Kindern ist noch viel Platz für reiche, bunte und wilde Spielerei und Fantasie. Aus dem Umgang mit ihnen wissen wir auch, wie außerordentlich „Out-of-the Box“ ihre Ideen und Vorstellungen sein können. Man muss sie nur fragen und ihnen zuhören. Umso seltsamer erscheint es aus dieser Perspektive heraus, dass wir ihnen zumeist als Erwachsene Geschichten, Spielzeug und Themen vorgeben. Wir haben die Erwachsensicht, das implizite Erfahrungswissen, wir haben bereits mentale Modelle der Welt gebildet, wir haben Kompetenzen und selbst unsere Fantasie lässt sich übergeordnet in ein kulturelles, kollektives Wissen einordnen. Wir sind von Geburt an „Modellbildungsmaschinen“: Unsere Intelligenz bildet sich durch Transferleistung und Informationsverarbeitung immer mehr aus. Der Geist ist ein System, das sich ständig neu koordiniert und kalibriert, um ein kohärentes Weltbild zu schaffen, um Vorhersagen für die Zukunft treffen zu können (Friston, 2024). Im Sinne der „Active Inference“ nach Karl Friston äußert sich Neugierde als eine intrinsische Motivation, Unsicherheit durch aktives Erforschen der Umwelt zu reduzieren und das eigene Weltmodell stetig zu verfeinern. Unser Gehirn "updated" sich also ständig neu. Diese neuronale Konnektivität aktualisiert unser Gehirn mit jeder Erfahrung, nachhaltige Selbstorganisation, die durch aktives Schlussfolgern gesteuert wird. Neugier beschreibt selbstorganisierende Systeme, die aktiv Schlussfolgerungen ziehen und Beweise aus sensorischen Daten für ihr Weltmodell sammeln. Dieses informationssuchende Verhalten ist entscheidend, um Unsicherheiten zu reduzieren". Das schließt ein, kausale Strukturen in unserer Wahrnehmungswelt zu schaffen, unsere Umwelt aktiv zu erkunden und zu verändern. Intelligentes Verhalten besteht aus "Selbstevidenzierung". In der Praxis zeigen viele Erwachsene eine gewisse Zurückhaltung gegenüber unbekannter Technik – bestehende Überzeugungen und Erfahrungen schränken hier oft die neugiergetriebene Exploration ein. Dabei ist gerade diese menschliche Neugier, Offenheit und Verspieltheit ein Treiber für Kreativität und Innovation, der uns von (noch) rein datengetriebenen KI-Systemen unterscheidet.
Die erste digital „Native-born“ Generation Alpha, die zwischen 2010 und 2024 geborene Gruppe, verkörpert eine neue Ära der technologischen Integration und globalen Vernetzung. Sie sind im digitalen Raum und mit interaktiven Anwendungen aufgewachsen. Joe Nellis von der Cranfield School of Management beschreibt diese Generation bereits 2017 so: „First of all, the fundamental characteristic of the Alphas will be their relationship with IT. They’re born into it, not as a new development, an experiment and stumbling innovation, a toy to grapple with, but as a fully-formed service. An IT-enhanced life, mediating everyday roles and demands via a digital device, is already the norm for them. And this means changes in people’s psychological and physical relationships with the world, the assumption that interactions will be simple, easy and instant“ (Nellis, 2017). Alphas haben jederzeit direkten Zugang zu Informationen und gestalten ihre Mediennutzung individuell. Sie wählen Inhalte nach ihren Interessen und ihrem Zeitplan aus und nutzen dabei verschiedene On-Demand Angebote, Medien und Plattformen. Beispiele sind hier Video-Streaming-Dienste wie Netflix und YouTube, über Live-Streaming plus Interaktion in Echtzeit wie Twitch, über Musik von Spotify bis zu Online-Kursen, um im selbstgewählten Tempo und mit selbst ausgewählten Inhalten zu lernen. Diese Möglichkeiten und ihr technisches Wissen machen sie zu einer sehr agilen Generation. Sie sind neugierige Forscher und die Form der Interactive Fiction in Kombination mit bildgebenden KI-Systemen und LLMs sind für sie potenziell spannende Spielfelder. KI-Systeme und die Möglichkeiten, die sie bieten, holen sie dort ab, wo sie sich am liebsten aufhalten: im digitalen Raum, in digitalen Spielelementen und Narrativen, in digitalem sozialem Austausch, der Meme-Kultur. Content Creators und Influencer prägen die Mediengewohnheiten der Generation Alpha und dienen vielen als kreative Vorbilder. Patrick Mayer zum Beispiel, alias Paluten ist einer der bekanntesten deutschen Gaming-YouTuber und begeistert mit seinen Minecraft-Projekten und humorvollen Let's Plays. Und: Sie sind nicht auf der Suche nach Austausch oder Ablenkung, sie möchten erschaffen, kreieren, gestalten. World Building-Spiele wie Minecraft und Roblox sind noch einmal von Platz 5 im Ranking auf Platz 2 gestiegen (GWI, 2021). Die jüngste gemeinsame Studie der Forschungsunternehmen GWI und Razorfish, Marktführer im Bereich Marketingtransformation, betont: „Wechseln Sie vom Geschichtenerzählen zum Entwerfen von Spielen. Untersuchungen zeigen, dass die Generation Alpha durch Spiele mit ihrer Welt interagiert und sie zur Unterhaltung, zum Lernen und zum Sozialisieren nutzt“ (Razorfish, 2024).
Wer den Alphas zuschaut, zum Beispiel in regionalen Maker Labs und Hackspaces, kann sich ansehen, wie natürlich sie Software und Technik nutzen und ihre eigene Agenda verfolgen. Sie zweckentfremden Werke, verzerren, modulieren, nutzen sie in anderen Medien und Kontexten, ähnlich der Remix-Kultur, nur spielerischer, weniger mit einer Zieldefinition oder Reflexion. Der Neurowissenschaftler Karl Friston beschreibt diese „Agency“ als Teil der menschlichen Intelligenz, auf Basis von Neugierde und Repräsentation in der Welt sich Modelle über die Welt und Kontexte zu sammeln und diese wieder durch Selbstevidenz zu verifizieren (Friston, 2024). „In diesem Zusammenhang verstehen wir Intelligenz als die Fähigkeit, Beweise für ein generatives Modell der eigenen wahrgenommenen Welt zu sammeln, auch bekannt als Selbsterkenntnis. […] Derselbe Imperativ untermauert die gemeinsame Nutzung von Überzeugungen in Ensembles von Agenten, in denen bestimmte Aspekte (d. h. Faktoren) des generativen Weltmodells jedes Agenten eine gemeinsame Grundlage oder einen Bezugsrahmen bilden. Aktive Inferenz spielt eine fundamentale Rolle in dieser Ökologie des Glaubensaustauschs, was zu einer formalen Darstellung kollektiver Intelligenz führt, die auf gemeinsamen Erzählungen und Zielen beruht“ (Friston, 2022).
Es bildet sich dadurch die Entscheidungsfähigkeit und die nachhaltige Fähigkeit, Schlussfolgerungen zu ziehen, aus. Friston et al. beschreiben in ihrer Veröffentlichung „Active Inference: A Process Theory“ (2017), wie ein System (zum Beispiel das Gehirn) aktiv Daten sammelt, um Vorhersagen treffen zu können und Unsicherheit zu reduzieren. Diese intrinsische Motivation, diese Art der „Selbstevidenzierung“ – beschreibt er 2024 in einem Interview im Magazin „human – Intelligenz und Zukunft“, als formalisiertes Modell von Neugier und Erfahrungswissen. In diesem Feld bewegt sich auch Daniel Martin Feige aus einer philosophischen Perspektive in einem Artikel der GEE: „Sie lassen sich genauso gut auf KI-Modelle übertragen. Mehrere kleinere neuronale Netze können zusammen auf kooperative Art in Interferenz (Schlussfolgerung) immer näher an die menschliche Intelligenz und die Art der Datenverarbeitung kommen. Was ihr (noch) fehlt, ist die Weltbeziehung in der Welt (Feige, 2024) und der Bezug darauf.
Friston schreibt dazu im Interview (2024): „LLMs haben vielleicht ein Weltmodell [...], die Regelmäßigkeit zeigen, aber es fehlt ihnen an Handlungsfähigkeit (agency). Zu echter Intelligenz gehört die Interaktion mit der Umwelt und anderen Agenten, es fehlt ihnen die „Handlungsfähigkeit und das von Neugier getriebene Verhalten, das für natürliche Intelligenz entscheidend ist.“… „Für aktives Denken, also kausale Strukturen in unserer Wahrnehmungswelt zu schaffen, unsere Umwelt aktiv zu erkunden und zu verändern“ muss eine Maschine ihr Wissen auf physisch verkörperte Weise aktualisieren, indem sie entweder offen oder verdeckt Aktionen ausführt“ (Friston, 2024 ).
KI und ihre Möglichkeiten und das narrative Genre der Interactive Fiction bieten in Verbindung eine einzigartige Form, um die Neugier, die menschliche Intelligenz voranzutreiben, Entscheidungsfähigkeiten und zukunftsweisende Selbstevidenz und Schlussfolgerungen der jungen Zielgruppe zu fördern. Für einen zukünftigen Umgang mit KI-Systemen, der die Arbeitswelt transformiert, müssen wir uns bewusst werden, was uns als Menschen auszeichnet. Wenn KI-Systeme besser schreiben als wir, müssen wir kritischer lesen lernen, wenn KI-Systeme besser antworten, sollten wir aufmerksamer zuhören lernen (Human, 2024). Technologische, digitale und transformative Kompetenzen, wie digitale Kollaboration, Urteilsfähigkeit, Dialog und Konfliktfähigkeit, werden in Verbindung mit klassischen Kompetenzen wie Problemlösungsfähigkeit, Empathie und Kreativität zu Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts. Interactive Fiction als didaktisches Mittel bietet breitgefächerte Möglichkeiten, die diese Fähigkeiten und Kompetenzen fördern können.![]()
Literaturverzeichnis


Nadine Trautzsch
Prof. Nadine Trautzsch ist Dipl.-Designerin, Illustratorin und Game Designerin. Zusammengefasst: System und Experience Designerin für digitale und analoge Medien. Sie ist Professorin an der IU Internationalen Hochschule und lehrt im Fachgebiet Design & Architektur im Studiengang Game Design und Game Art.
Website